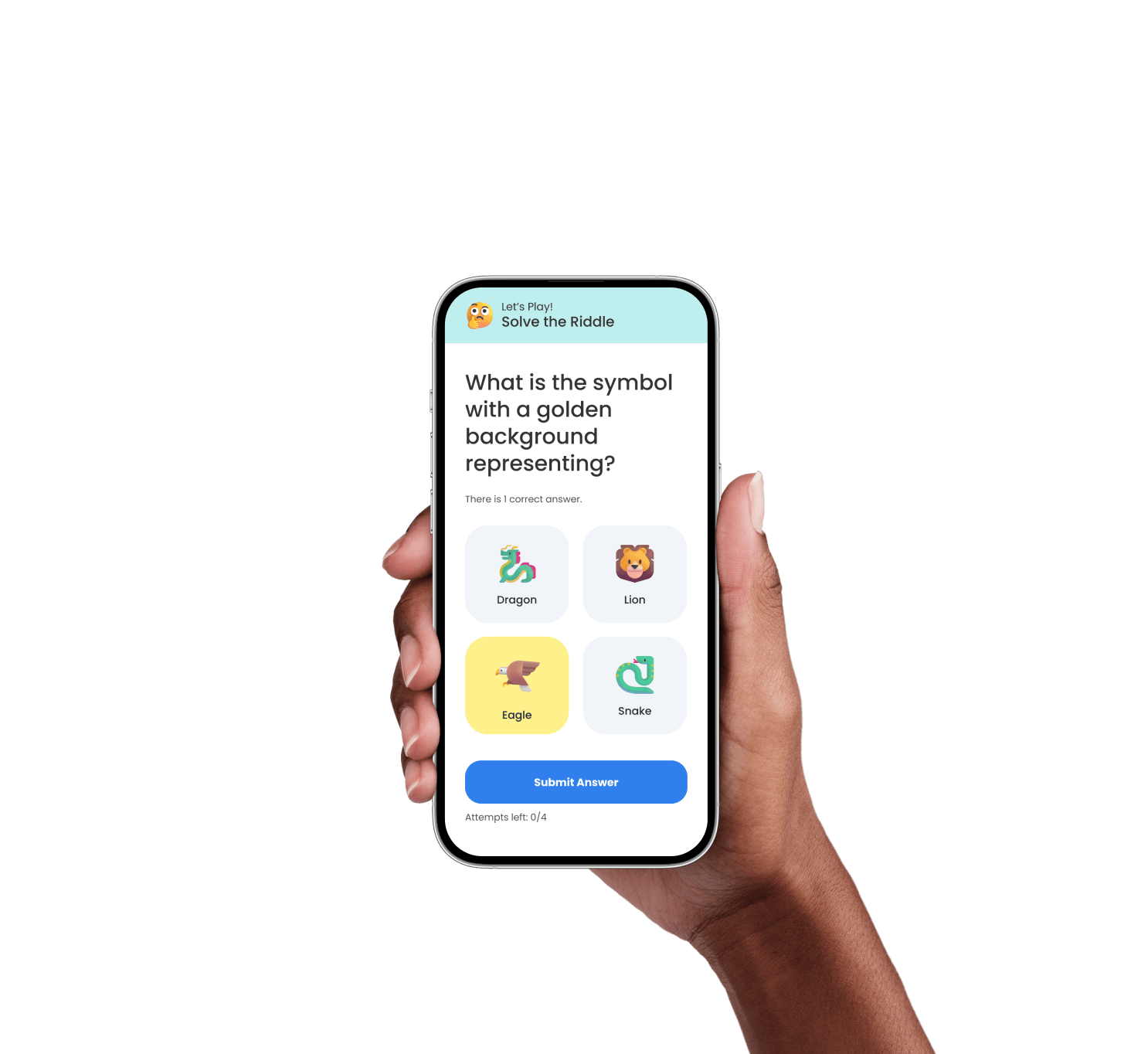Barcelona anarchica: Als die Stadt noch den Menschen gehörte
Ein seltener Moment in der Geschichte, in dem die Arbeiter die Zügel in die Hand nahmen und die Straßen mit Möglichkeiten pulsierten
Lass mich dich in ein anderes Barcelona entführen - nicht in das von Gaudís Kurven oder dem Trubel am Strand, sondern in eine Stadt mit roten und schwarzen Fahnen, in der Straßenbahnen ohne Chefs fuhren und Cafés zu Gemeinschaftsküchen wurden. Von Juli 1936 bis Mai 1937 wehrte sich Barcelona nicht nur gegen den Faschismus - es erfand sich neu.
Eine Philosophie, die in Werkstätten und Klassenzimmern entsteht

Bevor es die Barrikaden gab, gab es Bücher. Die anarchistische Bewegung in Katalonien stützte sich auf jahrzehntelanges Denken und Mühen: libertärer Sozialismus, rationalistische Bildung und von Arbeitern geführte Gewerkschaften wie die CNT. Im Mai 1936, nur wenige Wochen vor Ausbruch des Bürgerkriegs, skizzierte der Kongress der CNT in Saragossa eine Vision des "libertären Kommunismus" - keine Bosse, kein Staat, nur eine Föderation selbstverwalteter Gemeinden.
Das waren keine abstrakten Träume. Die Ferrer Modern School hatte bereits in ganz Spanien säkulare, wissenschaftlich fundierte Bildung in die Klassenzimmer gebracht. Die Schüler lernten nicht Gehorsam, sondern freies Denken. Als Francos Putsch in Barcelona im Juli dieses Jahres scheiterte, wurden aus Idealen Taten.
Arbeiterinnen und Arbeiter im Sattel

Es dauerte nur wenige Tage. Ende Juli 1936 waren rund 75 % der katalanischen Wirtschaft - von der Straßenbahn bis zur Textilfabrik - in den Händen der Arbeiter. Manager, die geflohen waren, wurden durch gewählte Betriebsdelegierte ersetzt. Die Züge fuhren. Theater öffneten. Die Straßen wurden gefegt. Nicht durch ein Wunder, sondern durch kollektive Koordination.
Ein Dekret, das im Oktober verabschiedet wurde, legalisierte diese Übernahmen. Es verband die Fabriken in Industrieräten und schuf einen Fonds zum Teilen der Ressourcen. Die profitablen Industrien unterstützten die schwächeren - gegenseitige Hilfe als Politik, nicht als Wohltätigkeit.
Gesundheit und Wohlfahrt, neu gedacht

Die Revolution machte nicht an den Werkstoren halt. Sie reichte bis in die Küchen, Kliniken und Klassenzimmer. Federica Montseny, eine Anarchistin und Spaniens erste weibliche Kabinettsministerin, schuf Entbindungsheime, Flüchtlingsunterkünfte und legalisierte die Abtreibung - eine Premiere in Spanien, die als Gesundheitsrecht für Frauen aus der Arbeiterklasse galt.
Nachbarschaftsausschüsse eröffneten kostenlose Kliniken, Unfallkassen und Renten. In der Zwischenzeit organisierten lokale Ernährungsräte Großhandelslager, transportierten Produkte per LKW und versorgten täglich Tausende in Gemeinschaftsküchen. In den Fabriken wurden Kinderkrippen gebaut, damit Mütter arbeiten gehen konnten, ohne ihre Kinder zurückzulassen. Bildung wurde kostenlos, rationell und in der Würde aller Menschen verankert.
Wohnen ohne Vermieter

Das Privateigentum fand ein schnelles und stilles Ende. In den ersten Wochen wurden über 500 Gebäude enteignet - von stattlichen Villen bis hin zu Mietskasernen. Viele wurden zu Schulen, Gewerkschaftshallen oder Notunterkünften für Flüchtlinge. Die Mieten wurden abgeschafft. Familien wurden zu Kollektivmietern, die von Wohnungsräten beaufsichtigt wurden. In wohlhabenderen Gegenden wurden verlassene Villen zu Wohnheimen für Bedienstete und Arbeiter.
In den Arbeitervierteln reparierten die Menschen die Slumgebäude mit Hilfe von Syndikatsgeldern und freiwilligen Helfern. Der Mietstreik von 1931 hatte die Armen Barcelonas bereits gelehrt, wie man sich organisiert - jetzt setzten sie diese Erfahrung stadtweit in die Praxis um.
Ein zarter Tanz mit Macht

Die Anarchisten haben die Macht nicht übernommen - sie haben sie abgebaut. Aber der Krieg erschwerte alles. Um an Waffen zu kommen und sich gegen Franco zu wehren, traten führende Vertreter der CNT-FAI sowohl der katalanischen als auch der spanischen Regierung bei. Einige Genossen nannten das Verrat. Andere hielten es für eine bittere Notwendigkeit.
Das Ergebnis war ein fragiler Waffenstillstand zwischen Revolution und Widerstand - ein Balanceakt, der mit jedem Monat schwieriger wurde.
Das Ende vom Anfang

Im Mai 1937 geriet dieses Gleichgewicht ins Wanken. Die Regierungstruppen, die nun zunehmend unter dem Einfluss der mit Moskau verbündeten Kommunisten standen, beschlagnahmten die von Anarchisten betriebene Telefonzentrale. Schüsse fielen auf den Straßen. Hunderte starben. Der Traum von einer staatenlosen Stadt begann zu zerbröckeln.
Am Ende des Sommers waren die meisten revolutionären Komitees aufgelöst. Der Staat - mit seinen Ministerien, der Polizei und der Hierarchie - war wieder da.
Was bleibt
Doch in diesen zehn Monaten lebte Barcelona eine andere Art von Realität. Eine Stadt ohne Vermieter. Ein Schulsystem ohne Priester. Ein Verkehrsnetz ohne Chefs. Die Straßenbahnen fuhren pünktlich. Das Brot kam an. Und die Menschen nannten sich gegenseitig "Genosse" und nicht "Herr".
Das war keine Utopie. Aber es war real. Und für alle, die sich schon immer eine freiere Welt vorgestellt haben, ist Barcelonas anarchistisches Experiment mehr als nur Nostalgie - es ist der Beweis.
Wenn du heute durch die ruhigen Seitenstraßen von Poble-sec oder Sant Andreu gehst, kannst du vielleicht ein Echo hören - von einer Zeit, in der die Stadt mit einer Stimme atmete und diese Stimme den Menschen gehörte.